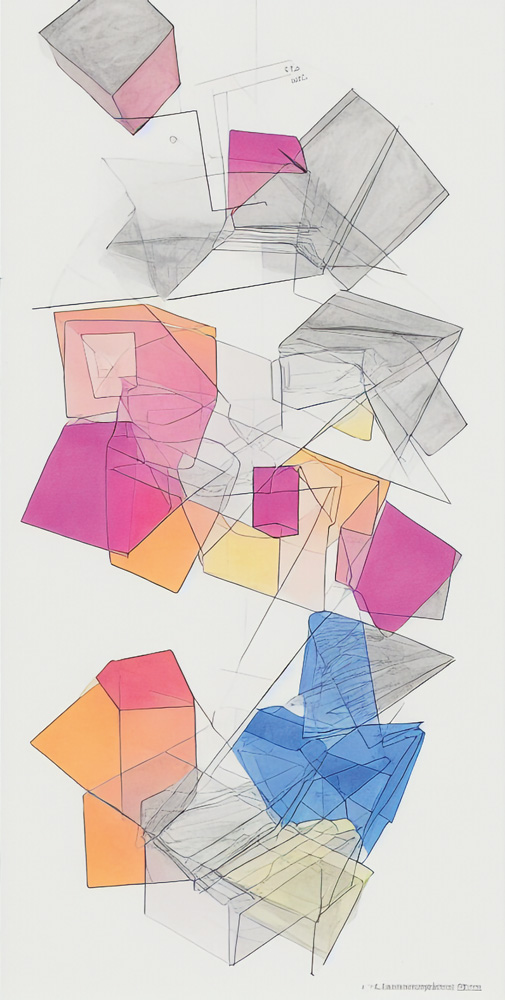SON 14. SEP 7 pm
Thomas raab
Intelligenz & Phantasie
Präsentation und Gespräch mit Emma Dowling Universität Wien
und Felix Stalder Zürcher Hochschule der Künste.
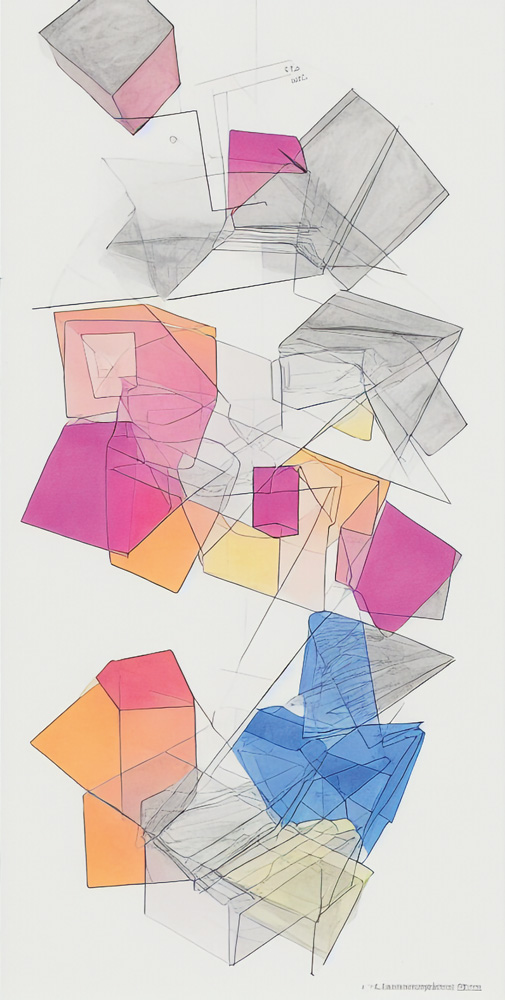
Illustration: Dominik Hruza
Z
äumt man das generative KI-Pferd von der Technikseite auf, zeigen sich interessantere Dinge als die Science Fiction der Futurolog*innen und Mahner*innen. Die Funktionsweise generativer KI ist wie bei allen bisherigen Programmen geprägt von der Spezifizierung des Problems, das sie lösen soll. Dieses muss im Falle KI im Vorhinein sehr stark idealisiert werden.
Bei Chatbots zum Beispiel ist dies die Herstellung alphanumerischer Zeichenketten, die Nutzer*innen als „sinnvolle Ausdrücke“ deuten sollen. Die Generierung wird durch verbesserte Hardware, großen Stromverbrauch, große Datenmengen und statistische Kniffe möglich, die die Verrechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten über große Textmengen kontextualisieren. Die Sprache wird zum Korpus aller bisher dokumentierten Äußerungen formalisiert. Ein „Sprachmodell“ wird so zu einem Buchstaben-, Wort-, Satz- und Langtextmodel, was die vielen Funktionen der Sprache zu einem Witz degradiert. Bei der Betrachtung dieser eingeschränkten Funktionsweise wird deutlich, dass die Problemlösungen nur möglich wurden, weil die bürokratische Verwaltung die dazu nötigen Daten bereits vorbereitete. Das Problem, das KI löst, ist ein menschengemacht karikaturhaftes Problem.
Psychologisch interpretiert Raab Intelligenz nicht als Problemlösung, sondern als das individuelle und kreative Suchen und Finden von Problemen. Dies kann nur auf Grundlage von expliziter Erinnerung, bewusstem Probehandeln („Denken“), Phantasie und einer ins Soziale eingebetteten Lebensgeschichte passieren.
Thomas Raab, Phantasie & Intelligenz: Zwei Essays zu künstlicher und menschlicher Intelligenz. Berlin: Parodos. 139 Seiten, EUR 14,90, mit 11 Abbildungen, ISBN 9783968240367
 Undisciplined Intelligence
Undisciplined Intelligence
A series by Technopolitics of dialogues beyond the disciplines.
Intelligence has long been regarded as a central and unique characteristic of humans, and yet ‘intelligence’ has always been a problematic term. Since it came into (pseudo-) scientific use towards the end of the 19th century, it has not been possible to define the term clearly. Nevertheless, or perhaps precisely because of this, its use is currently expanding rapidly. Towards machines in the form of artificial intelligence, and a growing number of non-human organisms whose higher cognitive functions are being analysed.
The question of intelligence is not only of interest within various scientific disciplines, but far beyond them. It directly or indirectly concerns the relationship of humans to the world and their position in it. The change in the concept of intelligence accompanies and reflects the constant change in the self-perception of different societies. This means that our understanding of intelligence is inevitably culturally characterised and has political consequences.